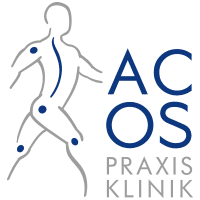Schultersteife

Dr. med. Michael Acker
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, ambulante Operationen
Spezialgebiet Schultergelenk
Dr. med. Michael Acker ist am 03.01.2011 als Nachfolger von Dr. Herbert Kübel in die orthopädische Gemeinschaftspraxis eingetreten. Zusätzlich zur klassischen Orthopädie ist der operative Schwerpunkt die Spezialisierung auf dem Gebiet der minimalinvasiven Schulter- und Ellenbogenchirurgie.
Schultersteife
Behandlung
In der ersten Phase kann mittels Cortison-Stufenschema versucht werde, den Kapselreiz zu minimieren und anschließend mittels intensiver Physiotherapie das weitere „Einsteifen“ zu verhindern. Dennoch verbleiben oft Funktionseinschränkungen, Bewegungs- und Ruheschmerzen, oder die lange Krankheitsdauer wird nicht toleriert. In diesem Fall besteht die Möglichkeit der operativen Intervention.
Operation
Standard ist die arthroskopische Operation. Über kleinen Hautschnitte werden Kamera sowie Arbeitswerkzeuge in die Schulter eingeführt. Somit lassen sich alle Bereiche des Gelenkes darstellen. Es wird arthroskopisch die geschrumpfte Gelenkkaspel durchtrennt, bis das Gelenk frei beweglich ist. Im subakromialen Raum – dem Gleitraum der Sehne – werden die entzündeten Weichteile (krankhaft veränderter Schleimbeutel) unter dem Schulterdach entfernt. Die Vergrößerung des subakromialen Gleitraumes erfolgt durch die Entfernung der knöchernen Veränderungen des Schulterdaches mit Hilfe minimalinvasiver Präzisionsfräsen.
Nachbehandlung
Nach der Operation ist der Arm nicht fixiert und darf/soll im schmerzfreien Bereich eingesetzt werden. Begleitend werden physiotherapeutische Behandlungen unter Berücksichtigung der Schmerzgrenze sowie passive Übungen auf einer Schulterbewegungsschiene (nach Genehmigung durch die Krankenkasse) durchgeführt. Leichte Arbeiten sind nach 3-4 Wochen, leichtere Überkopfarbeit nach 8-10 Wochen und schwere körperliche Arbeit nach 12-14 Wochen möglich. Freie Beweglichkeit ist trotz intensiver Nachbehandlung teilweise erst nach 6 (-12) Monaten erreicht. Die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität ist abhängig von der spezifischen sportlichen Belastung und wird individuell abgesproche
Schultersteife
Behandlung
In der ersten Phase kann mittels Cortison-Stufenschema versucht werde, den Kapselreiz zu minimieren und anschließend mittels intensiver Physiotherapie das weitere „Einsteifen“ zu verhindern. Dennoch verbleiben oft Funktionseinschränkungen, Bewegungs- und Ruheschmerzen, oder die lange Krankheitsdauer wird nicht toleriert. In diesem Fall besteht die Möglichkeit der operativen Intervention.
Operation
Standard ist die arthroskopische Operation. Über kleinen Hautschnitte werden Kamera sowie Arbeitswerkzeuge in die Schulter eingeführt. Somit lassen sich alle Bereiche des Gelenkes darstellen. Es wird arthroskopisch die geschrumpfte Gelenkkaspel durchtrennt, bis das Gelenk frei beweglich ist. Im subakromialen Raum – dem Gleitraum der Sehne – werden die entzündeten Weichteile (krankhaft veränderter Schleimbeutel) unter dem Schulterdach entfernt. Die Vergrößerung des subakromialen Gleitraumes erfolgt durch die Entfernung der knöchernen Veränderungen des Schulterdaches mit Hilfe minimalinvasiver Präzisionsfräsen.
Nachbehandlung
Nach der Operation ist der Arm nicht fixiert und darf/soll im schmerzfreien Bereich eingesetzt werden. Begleitend werden physiotherapeutische Behandlungen unter Berücksichtigung der Schmerzgrenze sowie passive Übungen auf einer Schulterbewegungsschiene (nach Genehmigung durch die Krankenkasse) durchgeführt. Leichte Arbeiten sind nach 3-4 Wochen, leichtere Überkopfarbeit nach 8-10 Wochen und schwere körperliche Arbeit nach 12-14 Wochen möglich. Freie Beweglichkeit ist trotz intensiver Nachbehandlung teilweise erst nach 6 (-12) Monaten erreicht. Die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität ist abhängig von der spezifischen sportlichen Belastung und wird individuell abgesproche

Dr. med. Michael Acker
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, ambulante Operationen
Spezialgebiet Schultergelenk
Dr. med. Michael Acker ist am 03.01.2011 als Nachfolger von Dr. Herbert Kübel in die orthopädische Gemeinschaftspraxis eingetreten. Zusätzlich zur klassischen Orthopädie ist der operative Schwerpunkt die Spezialisierung auf dem Gebiet der minimalinvasiven Schulter- und Ellenbogenchirurgie.